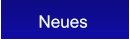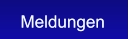Foto: EHang
Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive
Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive
Startseite
Electric Flight









Schnelle Navigation über Bildbuttons
für 58 Seiten oder über die Menüleiste oben
Kurz notiert: 09.04.2025 Die 31. AERO startete heute mit 756 Ausstellern aus 38 Nationen und mit so viel Flug-
zeugen wie noch nie. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine hohe Zahl Premieren auf der Messe………
02.04.2025 Aus den USA kommt von dem Batterieentwickler Sion eine hoffnungserweckende Information, dass
man zusammen mit der BASF eine Energiedichte von 400 Wh/kg, bzw. 780 Wh/l erreicht habe. Allerdings erreiche
man bis jetzt damit nur etwa 800 Ladezyklen für deren Liceron EV-Zelle. Ein wahrer Hoffnungsschimmer………
24.03.2025 Chinas eVTOL-Pionier Ehang plant den Bau einer Fertigungsstätte für seine Air-Taxis, obwohl bereits
in Österreich einige Baugruppen gefertigt werden. In Hefei soll ein größeres Werk entstehen. Der Automobilherstel-
ler setzt auch auf automatisierten Produktionstechnologien, die bereits im Automobilbau zur Anwendung kommen..
19.03.2025 Mit 2.200 Vorbestellungen hat Electra aus Manassas/Virginia einen Auftragsbestand über 9 Milliarden
US-Dollar. Die 9-sitzige EL9 ein Super-STOL mit Hybridantrieb wurde bislang bis auf Australien von vier Kontinen-
ten geordert. Darunter auch viele europäische Unternehmen und die deutsche Fluggesellschaft flyv. Das Flugzeug
kann dank seiner Super-Kurzstarteigenschaften von einer Startbahnlänge mit nur 45 Meter Länge auskommen und
ist 100 mal leiser als ein Hubschrauber…….19.03.2025 Zu einem Schäppchenpreis von 10 Millionen Euro gelang
es Diamond Aircraft das insolvente Unternehmen Volocopter zu kaufen. Nach Informationen aus Österreich soll
das eVTOL noch dieses Jahr die Zulassung der EASA erhalten. Gleichzeitig soll der Serienbau beginnen.
Allerdings seien noch einige technische Hürden zu überwinden…….

Anzeigen


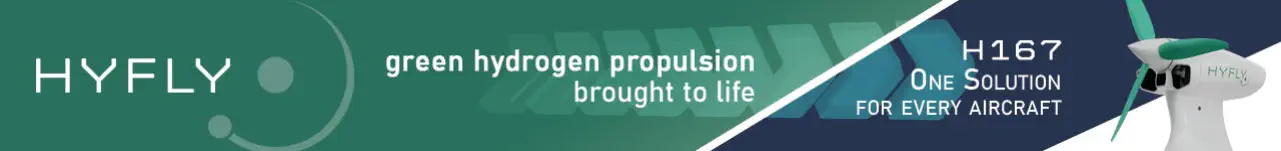
Einstellung der Serviceleistung mit Ende der AERO (12.3.2025). Nach 10 Jahren wird Electric Flight eingestellt.
Wir danken Ihnen als Nutzer dieser Webseite und wünschen Ihnen einen CO2-freien und lärmreduzierten Flug!

- ILA 2024
- Birdy
- Paris Airshow
- Aero 2024
- Aero 2023
- Aero 2022
- Aero 2019
- Aero 2018
- Aero 2017
- Aero 2016
- Aero 2015
- Electrifly-In 2021
- Electrifly-In 2020
- Smartflyer Challenge 2018
- Smartflyer Challenge 2017
- Elektrofliegertreffen Greiling
- Neue Airbus Strategie
- Airbus-Testflieger
- Solar Impulse
- Yuneec
- Leisere Tragschrauber







Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive
Startseite
Electric Flight
Anzeigen


Kurz notiert: 09.04.2025 Die 31. AERO startete heute mit 756 Ausstellern
aus 38 Nationen und mit so viel Flugzeugen wie noch nie. Die Besucher-
innen und Besucher erwartet eine hohe Zahl Premieren auf der Messe…..
02.04.2025 Aus den USA kommt von dem Batterieentwickler Sion eine
hoffnungserweckende Information, dass man zusammen mit der BASF ei-
ne Energiedichte von 400 Wh/kg, bzw. 780 Wh/l erreicht habe. Allerdings
erreiche man bis jetzt damit nur etwa 800 Ladezyklen für deren Liceron
EV-Zelle. Ein wahrer Hoffnungsschimmer……… 24.03.2025 Chinas
eVTOL-Pionier Ehang plant den Bau einer Fertigungsstätte für seine Air-
Taxis, obwohl bereits in Österreich einige Baugruppen gefertigt werden. In
Hefei soll ein größeres Werk entstehen. Der Automobilhersteller setzt
auch auf automatisierten Produktionstechnologien, die bereits im Automo-
bilbau zur Anwendung kommen.. 19.03.2025 Mit 2.200 Vorbestellungen
hat Electra aus Manassas/Virginia einen Auftragsbestand über 9 Milliar-
den US-Dollar. Die 9-sitzige EL9 ein Super-STOL mit Hybridantrieb wurde
bislang bis auf Australien von vier Kontinenten geordert. Darunter auch
viele europäische Unternehmen und die deutsche Fluggesellschaft flyv.
Das Flugzeug kann dank seiner Super-Kurzstarteigenschaften von einer
Startbahnlänge mit nur 45 Meter Länge auskommen und ist 100 mal leiser
als ein Hubschrauber…….19.03.2025 Zu einem Schäppchenpreis von 10
Millionen Euro gelang es Diamond Aircraft das insolvente Unternehmen
Volocopter zu kaufen. Nach Informationen aus Österreich soll das eVTOL
noch dieses Jahr die Zulassung der EASA erhalten. Gleichzeitig soll der
Serienbau beginnen. Allerdings seien noch einige technische Hürden zu
überwinden…….


Einstellung der Serviceleistung mit Ende der
AERO (12.3.2025). Nach 10 Jahren wird
Electric Flight eingestellt. Wir danken Ihnen
als Nutzer dieser Webseite und wünschen
Ihnen einen CO2-freien und lärmreduzierten
Flug!