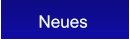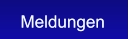Projekte

Foto: Messe-Friedrichshafen
Foto: Messe-Friedrichshafen
Die vorausschauende Böenlastabminderung als Lösung
Im Projekt oLAF hat das DLR intelligente Lastkontrollsysteme für Flugzeuge untersucht.
Sie sollen Flugzeuge effizienter und komfortabler machen, indem sie die für das men-
schliche Auge unsichtbare Windböen frühzeitig erkennen und Steuerflächen automa-
tisch anpassen. So lassen sich Treibstoffverbrauch und Belastung der Tragflächen deut-
lich senken. Im nächsten Schritt soll die Technologie in Forschungsflügen erprobt
werden.
Schwerpunkt: Luftfahrt, Klimaverträgliches Fliegen
Das Fliegen soll komfortabler und effizienter werden. Dabei können unter anderem in-
telligente Lastkontrollsysteme helfen, die vorausschauend auf Windböen und Manöver
reagieren, indem sie Steuerflächen und Klappen blitzschnell anpassen. Die Wissen--
schaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) kamen im Projekt oLAF (Optimal Lastadaptives Flugzeug) zu dem Ergebnis, dass
ein Einsatz dieser innovativen Technologie die Belastung der Tragflächen reduziert und
den Passagierkomfort erhöht. Der Treibstoffverbrauch sinkt um bis zu 7,2 Prozent und
die CO2-Emissionen verringern sich deutlich.
„Durch das geschickte Zusammenspiel hochentwickelter Steuerflächen und moderner
Sensoren, können wir Turbulenzen besser abfedern, die Belastung auf die Flugzeug-
struktur minimieren und so effizientere Flugzeuge entwickeln“, erklärt Dr. Lars Reimer,
Projektleiter des DLR-Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik. Das geschieht
unter anderem mit Lasersystemen und sogenannten LiDAR-Sensoren, die Windfelder
per Laser vermessen und herannahende Böen frühzeitig erkennen können. Durch diese
Sensoren kann das Flugzeug noch präziser und vorausschauender auf äußere Einflüs-
se reagieren und Steuerflächen wie Ruder oder Klappen automatisch anpassen. „Der
Einsatz hochmoderner Lastkontrollsysteme reduziert nicht nur die Materialbelastung
und die Lebensdauer, sondern verbessert gleichzeitig die Aerodynamik und den Wir-
kungsgrad moderner Verkehrsflugzeuge“, so Reimer weiter.
Simulationen und Tests bestätigen großes Potenzial
Im Projekt oLAF haben die DLR-Forscherinnen und -Forscher untersucht, wie sich der
umfassende Einsatz von Lastkontrolltechnologien auf den Entwurf eines neuen Lang-
streckenflugzeugs auswirkt. Um das mögliche Potenzial der Technologie genau ab-
schätzen zu können, haben sie mittels multidisziplinärer numerischer Simulation zwei
Flugzeugentwürfe mit identischen Anforderungen am Computer entwickelt und anschlie-
ßend miteinander verglichen: eins mit herkömmlicher Technik und eines, das kon-
sequent, von Entwurfsbeginn an, auf hochmoderne, sogenannte aggressive Lastredu-
zierung ausgelegt ist. Der entscheidende Unterschied: Die neue Technologie ermög-
licht Tragflächen mit größerer Spannweite und höherer aerodynamischer Effizienz – ein
Paradigmenwechsel, der Treibstoffverbrauch und Emissionen erheblich senkt.
Um diese Ergebnisse abzusichern, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
des DLR-Instituts für Aeroelastik Versuche im Niedergeschwindigkeitswindkanal Braun-
schweig (DNW-NWB) durchgeführt. Dafür haben sie das Windkanalmodell eines elas-
tischen Flügels mit beweglichen Hinterkantenklappen und Spoilern versehen und mit-
hilfe eines eigens entwickelten mobilen Böengenerators künstliche Böen erzeugt. Die
Schwingungen am Flügel wurden mit und ohne eingeschaltete Lastregelung verglichen.
Das Resultat: Mit aktivierter Lastregelung konnten die Schwingungen effektiv reduziert
und die Belastung am Flügelansatz um bis zu 80 Prozent verringert werden.
Effizientere Tragflächen durch moderne Lastkontrolle
Die Erkenntnisse aus den Simulationen und den Versuchen zeigen: Wenn eine umfas-
sende Lastkontrolle bereits im Flugzeugentwurf berücksichtig wird, ermöglicht sie leich-
tere, höher gestreckte Tragflächen, die aerodynamisch besser sind und Treibstoff spa-
ren. Das Flugzeug mit der neuen Technologie verbraucht den Abschätzungen zufolge
bis zu 7,2 Prozent weniger Treibstoff und kann trotz möglicher zusätzlicher Wartungs-
kosten die Wirtschaftlichkeit um bis zu 6,7 Prozent steigern. „Die Ergebnisse haben uns
überrascht“, sagt Lars Reimer. „Während wir die Lastkontrolle anfangs vor allem als
Methode zur Gewichtsreduktion gesehen haben, stellt sie sich jetzt vielmehr als
Schlüsselelement für den Entwurf der Tragflügel von Morgen dar - mit deutlich
02.03.2025
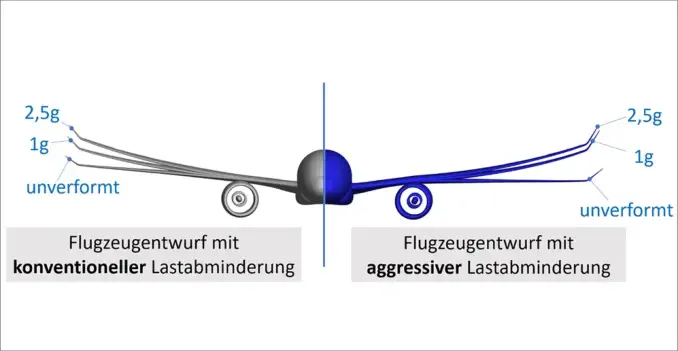
Das experimentell in der Messstrecke des Niedergeschwindigkeitswindkanals unter-
suchte Flügelmodell und der stromauf angeordnete Böengenerator ermöglichen eine
detallierte Analyse der Strömungsverhältnisse


verbesserter Aerodynamik und höherer Effizienz.“
Nächste Schritte: Technologie in die Luft bringen
Das DLR plant nun, die Technologie weiterzuentwickeln und ausgewählte erste Prototypen in Forschungs-
flugzeugen zu testen. Parallel dazu setzen die Forschenden die Arbeiten aus oLAF fort. Sie wollen den di-
gitalen Entwurfsprozess, der alle relevanten Disziplinen – von der Aerodynamik über die Struktur bis hin zur
Lastkontrolle – integriert, weiterentwickeln. Ziel ist es, Flugzeugherstellern eine Vorgehensweise aufzu-
zeigen und hochpräzise Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie bereits in der frühen Entwurfs-
phase Lastminderungstechnologien in ihre Designs einplanen können.
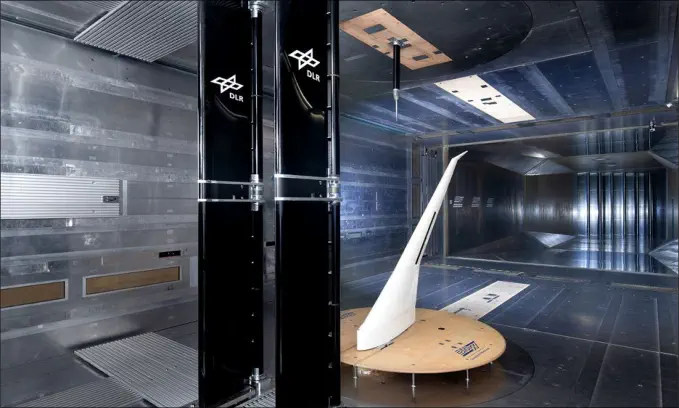
Verformungsverhalten der Flugzeugentwürfe mit konventioneller (links) und aggressiver
Lastabminderung (rechts) im Reiseflug (1g) und bei einem Abfangmanöver (2.5g). Die
Lasten beim Abfangmanöver sind fast auf das Niveau der Lasten im Reiseflug abge
mindert, wie sich in der Verformung zeigt.
Schnellreagierende Klappensysteme sollen Passiere und das Flugzeug selbst vor störenden Böen schützen. Das DLR hat herausgefunden, wie es umsetzbar ist.
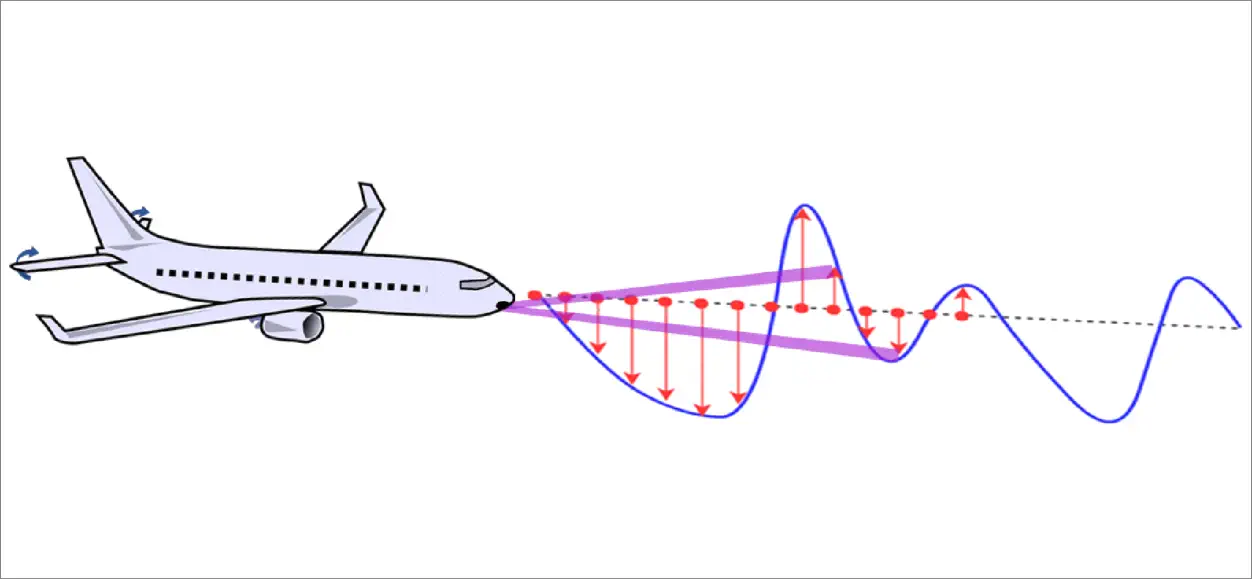
Bild: Chrisalion
Bild: DLR
Bild: DLR
Bild: DLR
Foto: Messe-Friedrichshafen
Foto: Messe-Friedrichshafen
Foils und verteilte Antriebe als Lösung für Seaglider
Es ist wohl eine maritime Tradition, dass Stapelläufe immer montags erfolgen.
Dies lehren uns zumindest die Macher des Viceroy Seaglider, einem Aerofoil-
Gleitboot, halb Schiff - halb Flugzeug. REGENT Craft Inc. ist das Unternehmen,
das nach anfänglichen Modellversuchen aus einem 1:4-Modell nun die erste Ori-
ginal-Version für 12 Passagiere am 3. März zu Wasser brachte. REGENT leitet
sich aus Regional Electric Ground Effect Nautical Transport ab.
Kein anderes Luftfahrt-Projekt wurde so schnell realisiert wie der Seaglider mit verteilten
elektrischen Antrieben. Mit 12 Passagieren bei komfortablen Bestuhlungen soll der Sea-
glider bis zu 300 km/h Reisegeschwindigkeit über die Fluss- und Küstengewässer brin-
gen. In der Cargoversion werden 1.600 kg möglich sein. Die Angaben über die Ge-
räuschentwicklung sind mit 30 dB unter den Lärmwerten etwas vage auf Flugzeugen
oder Hubschraubern bezogen. Dabei muss das Unternehmen nichts hinter dem Berg
halten, denn der Flügel des Seaglider wird mit 12 Elektromotoren bestückt, die unter der
Flügelvorderkante befestigt werden. Die Spannweite beträgt 19,80 Meter und die Länge
des schiffförmig ausgebildeten Rumpfes beträgt 17,72 Meter. Anderes als bei Flugzeu-
gen dieser Größenordnung muss der Seaglider von zwei „Piloten“ geflogen werden.
Das 6.500 kg schwere „Flugobjekt“ soll eine Startleistung von 960 kW bekommen. Die
Antriebsmotoren sind rein batteriebetrieben!
Einheitliche Sicherheitsstandards wie bei Wasser- und Luftfahrzeugen
REGENT strebt an, die Kosten des regionalen Transports zwischen Küstenstädten dras-
tisch mit ihrer Konstruktion zu reduzieren. Ihr als Viceroy Seaglider bezeichnetes Fahr-
zeug ist ein Flügel-im-Boden-Effekt-Flugzeug, das wenige Meter über der Wasserober-
fläche operiert und die hohe Geschwindigkeit eines Flugzeugs mit den niedrigen Be-
triebskosten eines Bootes verbindet. Das Vehicle wird nach den gleichen Sicherheits-
standards wie alle modernen Luft- und Wasserfahrzeuge gebaut und wird mit heute vor-
handener Batterietechnologie Strecken von bis zu 180 Meilen (290 km) schaffen.
Know-how von ehemaligen Boeing-Ingenieuren
Bereits mit der nächsten Batteriegeneration sollen Strecken von bis zu 500 Meilen (800
km) bewältigt werden. Der Vorteil ist, dass ein solches Passagiertransportsystem alle
vorhandenen Dockinfrastrukturen nutzen kann. Das Team aus MIT-ausgebildeten und
ehemaligen Boeing-Ingenieuren nutzt Entwicklungspfade für maritime Fahrzeuge, um
den emissionsfreien Hochgeschwindigkeits-Seegleiter in kürzester Zeit auf den Markt zu
bringen.-
Wie alle modernen Cockpits wird auch REGENT’S Seaglider mit modernen Glascock-
pits und einem Autopiloten ausgestattet. Dazu kommt ein Verkehrsberatungssystem für
Luft- und Seefahrt, eine Infrarotkamera und ein vorausschauendes Sonar.
Im Hintergrund ein dick gefülltes Auftragsbuch
REGENT ist ein durch Risikokapital finanziertes Startup, dessen Finanzierung von Thiel
Capital und JAM Fund geleitet wird. Das Auftragsbuch ist mit über 7,9 Milliarden US-
Dollar von Fluggesellschaften und Fährunternehmen, einschließlich fester Anzahlungen
für die ersten Auslieferungen von Seaglidern gut gefüllt.
Technik-Chef war selber mit an Bord
Der erste Schwimmtest in der Narragansett Bay südlich von Boston/USA mit ersten Be-
schleunigungsversuchen auf der stillen Wasseroberfläche bestätigten seinen Machern,
dass man zielorientiert auch Zeitvorgaben durchaus einhalten kann. Auch Mike Klinker,
Mitbegründer und CTO von REGENT, selber mit an Bord im Zweimann-Cockpit, zeigte
sich begeistert. „Das erste Mal vom Dock auf den Viceroy Seaglider-Prototyp zu steigen
war surreal“ und weiter „Ich fühlte mich geehrt, im Cockpit zu sein, als es das Dock zum
ersten Mal verließ und mit den Seeerprobungen begann. Dies war die erste Reise eines
Schiffes, das die Mobilität verändern wird – die Ära der Seaglider hat begonnen.“
Dank „Foils“ kann eine neue Ära mit dem Viceroy Seaglider beginnen
Frühere deutsche Konstruktionen, auch die in den siebziger und achtziger Jahren
durchgeführten Versuche mit Airfoils, sind nie richtig aus dem Experimentalstadium
herausgekommen. Zwischenzeitlich haben die kurz als „Foils“ genannten Unterwasser-
tragflächen aber besonders bei Hochleistungsyachten Furore gemacht. Sie sind meist
beweglich und können vom Inneren des Bootskörper ein- und ausgefahren werden.
Zwei Foils hat der Seaglider unter seinem Rumpf, der zusammen mit den „verteilten
Antrieben“ auftriebserhöhend wirkt und den Seaglider nach kürzesten Zeit der Be-
schleunigung aus dem Wasser hebt. Der geringe Abstand über dem Wasser führt dann
zum Bodeneffekt und das „Schiff-Luftfahrzeug“ lässt sich dann wie ein Flugzeug steu-
ern. Die unter dem Tragflügel aufgestaute Luft wirkt dann aber nur auf bis wenige Meter
Höhe. Dort ist die Auftriebskraft größer als bei frei umströmten Flügel. In diesem Bereich
kann dann der Pilot sogar die Antriebsleistung eines solchen Seagliders extrem redu-
zieren. REGENTs Viceroy Seaglider hat so die Chance, zu einem großen Erfolg zu
werden, doch nun muss es auch in der erweiterten Erprobungsphase seine Boden-
effekt- und Flugtüchtigkeit erweisen.
06.03.2025
VIP-Passagiere dürfen im Viceroy Seaglider in Clubsesseln die „Überflüge“ genießen



Fluss- und Küstenregionen sollen ebenso wie vom Festland nahegelegene Inseln schnell und bequem erreicht werden - eine alte Idee, die Furore machen könnte
Bild: Chrisalion

Feierliche Taufe Anfang März 2025 an einem Kai an der Narragansett Bay

Der am Kai angelegte Viceroy Seaglider wurde nach ersten erfolgreichen Schwimm-
versuchen wieder an Land gezogen. Demnächst erfolgt die Flugerprobung.

Von Kai zu Kai
Foto: REGENT
Foto: REGENT
Foto: REGENT
Foto: REGENT

Foto: Messe-Friedrichshafen
Foto: Messe-Friedrichshafen
Die Briten drängen in neue Kategorien vor
In Großbritannien wagt sich das Unternehmen Sora Aviation an die Entwicklung
eines eVTOL für 30 Passagiere. Gegenüber der in Entwicklung befindlichen
eVTOLs ist das der Faktor neun bis zehn. Sora Aviation rechnet vor, dass sich
nach dem Kosten-Nutzen-Faktor kleine VTOLs nicht rechnen würde, weil vier- bis
sechssitzige VTOLs ohnehin schon sehr viel teurer als Hubschrauber sind.
Das Konzept basiert auf einen Entenflügler, der über acht kippbare Rotoren verfügt. Das
als S-1 bezeichnete Muster verfügt über einen röhrenförmigen, langgestreckten Rumpf.
Einen ersten Kunden habe man auch schon mit dem koreanischen Hubschrauberbetrei-
reiber Moviation, der 20 Flugzeuge des Typs S-1 bestellt habe (MoU). Mit der am 10.
März unterschriebenen Vorbestellung erklärte man sich auch bereit, das eVTOL-Muster
S-1 auf dessen drei infrage kommende Hauptstrecken zu prüfen. Dazu gehören der
Jamsil Heliport (betrieben von Moviation) zum Flughafen Incheon, der vom Finanzviertel
Yeouido zum Flughafen Incheon und der Jamsil Heliport nach Sejong City, der geplan-
ten koreanischen Verwaltungshauptstadt.
Die Betriebskosten sinken durch höhere Passagierzahlen
Moviation-CEO Min Shin bezeichnete den S-1 als bahnbrechende Neuerung und sagte,
der eVTOL stehe im Einklang mit Südkoreas Plänen, den Übergang zur urbanen Luft-
mobilität zu beschleunigen. „Die größere Kapazität und die niedrigeren Betriebskosten
pro Passagier im Vergleich zu Hubschraubern und kleineren eVTOLs machen es ideal
für stark nachgefragte Strecken wie Jamsil nach Incheon“, sagte er.
Dichte Besiedlungen fordern nach urbaner Luftmobilität
Südkorea bietet mit seinen dichten städtischen Gebieten und der starken staatlichen
Förderung der urbanen Luftmobilität hervorragende Chancen für den eVTOL-Betrieb.
„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Moviation, um effiziente, skalierbare
eVTOL-Dienste nach Südkorea zu bringen“, sagte Furqan, CEO von Sora Aviation. „Die
S-1 ist nicht nur auf Effizienz ausgelegt, sondern soll auch dafür sorgen, dass urbane
Luftmobilität wirklich gleichzeitig für mehr Menschen zugänglich ist und dass das nicht
nur ein Luxusservice bleibt.“
Ist Sora Aviation S-1 der wahre Airbus?
Er fügte hinzu, dass Moviations Vorbestellung von 20 Flugzeugen „die Nachfrage nach
eVTOLs mit höherer Kapazität unterstreicht, die einen gleichberechtigten Zugang zur
Luftmobilität ermöglichen können.“ Die Gründer Furqan und Malcolm waren zuvor als
Experten für fortschrittliche Luftmobilität beim britischen GKN tätig. Schon 2018 ent-
wickelten sie das Konzept eines eVTOL-Busses – und verfolgen diese Vision seitdem
unermüdlich.
Sora Aviation zieht Know-how aus US-Unternehmen
Das in Bristol ansässige Unternehmen Sora Aviation arbeitet mit dem US-Unternehmen
Continuum Dynamics Inc. (CDI) zusammen, um die Flugdynamikmodellierung, Aerome
chanikanalyse und die Entwicklung des Proprotors für den 30-sitzigen eVTOL S-1 vor-
anzutreiben. CDI, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Aerodynamik von
Drehflüglern und hochpräzisen Simulationen, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in
der Unterstützung großer Luft- und Raumfahrtprogramme.
Förderungen nach denen sich andere Innovatoren sehnen
Furqan, CEO von Sora Aviation, erklärte: „Die umfassende Expertise von CDI in der
Kipprotordynamik stellt sicher, dass der S-1 für reale Betriebsherausforderungen
ausgelegt ist – von reibungslosen Übergangsphasen bis hin zur sicheren Bewältigung
seltener, aber kritischer Ausfallfälle.“ Diese Zusammenarbeit wird durch Fördermittel von
Innovate UK und der britischen Regierung unterstützt und stärkt Großbritanniens
führende Position im Bereich nachhaltiger Luftfahrttechnologien.
15.03.2025
Hochwirksame Rotorenanordnung im Marschflugbetrieb



Bild: Chrisalion
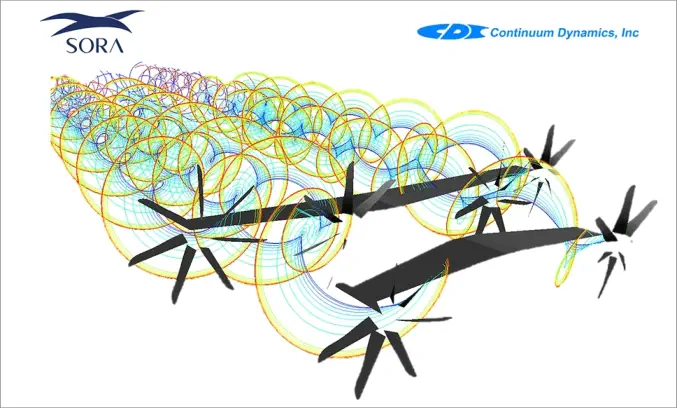
Die großen Rotordurchmesser erlauben hohe Reisefluggeschwindgkeiten

Die Masse soll´s bringen
Abbildung: Sora Aviation
Bild: Sora Aviation

Bild: Sora Aviation
Foto: Messe-Friedrichshafen
Foto: Messe-Friedrichshafen
Die AERO ist Vorreiter für die zukunftsweisende Elektroluftfahrt
Es wäre nicht Europas größte General Aviation Messe AERO, wenn sie keine Neuheiten zu
bieten hätte. Sie ist schlechthin das Schaufenster für alles was Flügel, Motoren und Roto-
ren hat. Genau zur rechten Jahreszeit im Frühling, wenn auch Aufbruchstimmung in den
verstaubten Flugzeughallen herrscht und wenn das Wetter zu neuen Nah- und Fernflügen
reizt, richtet sich der Blick auf große und kleine Flugmaschinen. Und wenn der Flug mit
dem Business Jet oder selbst mit der kleinen Zweimot zum Geschäftstermin wieder mehr
Lust verspüren lässt, anstatt zu stressgeladenen Bahnfahrten durch die Lande mit dem ICE
fahren zu müssen, finden sich die besten Gelegenheiten nach Neuem Ausschau zu halten.
Das gilt gleichwohl für jeden anderen Piloten, der auch nur zu seinem Freizeitvergnügen
fliegt.
Verheißungsvolle Ansätze CO2-frei zu fliegen, kommen aus der Allgemeinen Luftfahrt
Was man der Bahn zugutehalten muss, ist die nahezu CO2-freie Fortbewegungsart von A nach B.
Noch weit davon entfernt ist die Luftfahrt mit ihren selbstgesteckten Zielen, sich möglichst bald von
fossilen Brennstoffen zu lösen. Doch was die Allgemeine Luftfahrt betrifft, so ist man wie keine an-
dere Luftfahrtsparte bestrebt, erste brauchbare Lösungsansätze zu finden. Dafür steht die AERO!
Der Weg ist verheißungsvoll und heißt: elektrisches Fliegen, und dem widmet sich erneut die e-
expo-Halle A7, an der Ostflanke des Messegeländes parallel zum Bodensee Airport.
Bedarfsgerechte Viersitzer aus der Schweiz und China
Den Anfang dazu machten Segelflugzeughersteller mit ihren selbststartenden Motorseglern, denen
Motor-Experimentalflugzeuge folgten und zuletzt Pipistrel mit seinem Velis. Abgesehen mal von
anderen Einzelstücken. Ihnen folgen jetzt unter anderem die ersten Viersitzer wie der Smartflyer
aus der Schweiz oder die RX4 E aus China. Die Schweizer bewegen sich dabei noch auf vorsich-
tigem Terrain, mit einer Hybridlösung auf Basis eines Rotax-Kolbenmotors. CEO und Gründer des
Unternehmens Rolf Stuber, ehemaliger Swiss-Pilot, hat den Schwerpunkt dabei von Anfang an auf
eine freie Sicht aus dem Cockpit gelegt, während sich der eigentliche Antrieb im Heck befindet.
Die Arbeit macht das Hybridsystem im Bug, das 800 Kilometer Reichweite garantiert. Doch kon-
zeptionell haben die Schweizer haben gleich weitergedacht und sehen auch die Möglichkeiten für
reinem Batteriebetrieb (wenn die mit entsprechenden Leistungsdichte angeboten werden) und
auch den Brennstoffzellen-Betriebe vor.
Mit modifizierten Stemme S10 will Klaus Ohlmann 2000 Kiloter weit fliegen
Einen ähnlichen Weg hat Rekordpilot Klaus Ohlmann angestoßen, der in Karl Pickan den Exper-
ten, Besitzer der Firma Pimo, ebenfalls für einen Hybridantrieb fand. Pickan sieht für Ohlmanns
Stemme S10 zunächst eine reine Batterie-Variante mit einer 30 kWh Lithium-Batterie vor, die über
zwei redundante Inverter - einen slowenischen Emrax-Motor mit 75 kWh - antreibt. Dabei wird der
Rotax 914-Verbrenner durch den Elektromotor ausgetauscht. In der Phase zwei soll dann mittels
Range-Extender auf Basis eines Briggs & Stratton-Motors die Reichweite auf über 2000 Kilometer
erhöht werden. Der liefert aus dem angeflanschten kleinen Generator konstant Strom an die Puf-
ferbatterie. Mit 15 kW könne man dann so bis zu 20 Stunden im Kraftflug fliegen und das bei nur
etwa 5 Liter Kraftstoffverbrauch pro Stunde. Dieser smarte Verbrauch ist aber auch nur dank des
hochwertigen Flügels der S10 umsetzbar. „Eine Neuzulassung ist für das Flugzeug nicht erforder-
lich“, erklärte Pickan, „eine STC ist rein zulassungsmäßig ausreichend“. Noch einfacher sähe es
mit dem Einbau in ein Ultraleichtflugzeug aus. Schlucken doch die Verbrenner nicht selten je nach
Leistung bis zu 18 Liter/Stunde und das heißt, nicht nur höhere Treibstoffkosten, sondern auch
höhere Abflugmasse.
16.03.2025
Schweizer Hybrid-Viersitzer Smartflyer SFX1 fliegt mit sparsamem UL-Motor



Vom 9. bis 12. April findet die 31. AERO in Friedrichshafen am Bodensee statt. Zwei starke Elemente sind die e-flight-expo und die Fachkonferenz und das Summit.
Bild: Chrisalion

Der chinesische Elektro-Viersitzer hat bereits auch eine chinesische Zulassung
Die Basis des Hybrid-Antriebes für die Stemme S10 besteht aus einem Zwei-
zylinder V-Motor von Briggs & Stratton und ist mit 5 l/h zufrieden

Foto: Messe-FN
Foto: Smartflyer
Foto: Lianing
Foto: Pickan




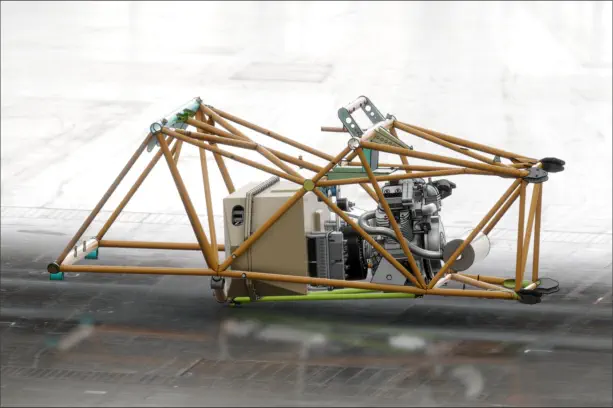
Extremer Leichtflugbau und ein hocheffizienter Geiger-E-Motor waren die
Grundlage für den doppelsitzigen Elektra-Tariner in der UL-Klasse
Urvater dieses Elektro-Einsitzers Alphafrog G1 war die französische Sirroco,
die in ihrer 120 kg-Klasse auch als KIT-Flugzeug erhältlich sein wird
Foto: Pickan


Als doppelsitziger Trainer zunächst mit Kolbenmotor für Kunstflug entwickelt,
ist Integral E jetzt das elektrische Folgemuster von Aura Aero aus Frankreich
Die e-Genius der Uni Stuttgart ist nicht nur imstande, weite Strecken zu
meistern, sondern sie bewährt sich auch als Segelflugzeugschlepper
Foto: Pickan


Cellsius, der Verein, der ETH-Zürich realisierte das E-Flugzeug von Sling Air-
craft und arbeitet in einem Folgemuster an einer Maschine mit Brennstoffzellen
Foto: Pimo
Foto: Elektra Solar
Foto: Alphafrog
Foto: AuraAero
Foto: Uni Stuttgart
Foto: Cellsius

Sozusagen Stand an Stand liegt das Duo Ohlmann/Pickan neben der Spornradversion des dop-
pelsitzigen UL-Doppelsitzers Elektra Trainer. Nach Jahren der Entwicklung ist er jetzt zugelassen
und auch in der reinen Zweibeinversion erhältlich. Erste Flugschulen wurden bereits durch eine
Kleinserie bedient. Allerdings kostet der Elektra Trainer inzwischen auch um die 250.000 € voll
ausgerüstet. Die UL-Fliegerei war schon mal preiswerter!
Universeller Doppelsitzer für Verbrenner und Kolbenmotor einsetzbar
Quereinsteiger ist Alphafrog, deren Stammunternehmen sich seine Brötchen eigentlich mit einem
Software-Unternehmen verdient. Das Basismuster fliegt mit einem EOS Quattro 30 HP Verbren-
ner, die Elektroversion erhält einen Geiger-Motor mit 20 kW (HPD20/40) was mit einer Auflastung
auf 300 kg generell den Einstieg in die Elektrofliegerei ermöglicht. CEO Marko Hirsch benennt für
den als eG1 bezeichneten Einsitzer dabei einen Kitpreis von zirka 50.000 Euro. Das UL mit erwei-
terter Zulassung gegenüber dem alten Muster, das Anfang der achtziger Jahre als Sirocco in
Frankreich entwickelt wurde, hat so gut wie überhaupt nichts mehr mit der heutigen eG1 zu tun.
Hirsch hat jedoch noch ehrgeizigere Ziele und das heißt, er möchte einen Viersitzer entwickeln,
der ein ähnliches Antriebssystem wie der e-Genius und der Smartflyer es besitzen, haben soll.
Sein eG4-Projekt hat dieselben Ansätze und wird ebenfalls auf Basis eines Rotax–Verbrenners
entwickelt. Daran wird bereits gearbeitet.
Experimentalflugzeuge von Studenten und deren weiterführenden Ergebnisse
Rein experimentell beschäftigen sich gleich mehrere Hochschulprojekte in der „Innovationshalle“
mit Brennstoffzellensystemen, es sind die der ETH-Zürich mit Cellsius, die Aero Delft und in Ko-
operation die THWS mit Kasaero. Letztere wollen den gemeinsam entwickelten Wasserstoffantrieb
auch für andere Projekte auf den Markt anbieten, da er auch skalierbar sei.
Vollkommen autonom präsentieren sich zum zweiten Mal die Chinesen mit ihren Viersitzern RX4E,
eines dieser Exponate wird unter anderem auch am 9.4.2025 wie auch andere Elektroflugzeuge in
die Luft gehen. Und genau das ist neu! Dass man in Zukunft den Elektro- und Wasserstoffflugzeu-
gen ein extra Zeitfenster in weiser Voraussicht schon ab diesem Jahr am jeweils ersten Messe-
nachmittag einräumt, ist ein Zugeständnis an Käufer und Flugenthusiasten, denn weitere Zulas-
sungen werden auch in den kommenden Jahren erwartet. So auch Aura Aero.
Aura Aero, der neue große Player aus Frankreich
Denn mit großen Schritten bewegte sich das französische Unternehmen Aura Aero in den Markt.
Integral E wird gleich in zwei Versionen, so auch in der Kolbenmotorversion präsentiert, doch man
wird auch einen ersten Rumpfspant des mehrmotorigen Elektroflugzeug ERA als 19-Sitzer zeigen.
Damit ist auch vorgezeichnet, dass in der Halle A7 durchaus größere Flugzeuge, solange sie noch
reinpassen, dort zu sehen sein werden. Mit von der Partie zugleich auch erneut wieder das allseits
kompetente DLR mit den Vertretungen verschiedener seiner Institute.
Zweitägiges Fachsymposium
Weitere große und kleine Hersteller von Elektromotoren, Generatoren, Brennstoffzellensystemen
und Beratungsunternehmen ergänzen die Angebote der Flugzeughersteller- und Ausrüster aus
Australien und primär aus europäischen Ländern.
Das DLR ist zugleich auch die Verbindung zu dem einen Stock höher gelegenen Vortragsraum, wo
schon einen Tag vor Messebeginn das zweitägige Symposium „AERO Hydrogen & Battery Sum-
mit“ (8.-9.04.) mit hochkarätigen Referenten aus der ganzen Welt von Australien über ganz Europa
und Nordamerika startet. Und danach seine Fortführung im Nebenraum mit Flugplatzexperten über
Infrastrukturen berät, wie schon heute Elektroflugzeuge elektrisch oder auch in Zukunft mit Was-
serstoff betankt werden können.
In 12 Hallen über 700 Aussteller
Weit mehr als 700 Aussteller sind dieses Jahr für Europas größte General Aviation Messe ge-
meldet. In der Masse sind Segel- und Ultraleichtflugzeuge, Motorsegler, Drohnen, Hubschrauber,
ein- und zweimotorige Motormaschinen sowie Business Aircrafts in insgesamt 12 Hallen unter-
gebracht. Der sogenannte AERO Business Aviation Show Hub welcher die Hallen A2, A3 sowie
das Business Aviation Static Display mit dem neu geschaffenen Business Aviation Dome bein-
haltet, präsentiert so viele Geschäftsreiseflugzeuge wie noch nie in der Geschichte der Messe und
bietet im neuen Dome sozusagen auch Begegnungsstätte für den VIP-Bereich.
Projektleiter der AERO, Tobias Bretzel, zeigt sich mit dieser Erweiterung zufrieden: Wir freuen uns
sehr über das Wachstum in dieser so innovative Branche und die Anknüpfungspunkte der Busi-
ness Aviation an die anderen Themen und Bereiche der AERO wie z.B. bei Zulieferern von Avi-
onik- und Cockpit-systemen und dem für die Luftfahrt so wichtigen Thema von nachhaltigen Kon-
zepten. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei der AERO tief verwurzelt, denn Ökologie und Ökonomie
gehen Hand in Hand. Der Flottenverbrauch der Flugzeuge liegt heute deutlich niedriger als noch
vor einem Jahrzehnt. Treibstoff, den man durch effizientere Betriebsabläufe oder höhere aerody-
namische Effizienz einsparen kann, muss man auch nicht kaufen. Wir freuen uns sehr, mit der
AERO 2025 wieder einen Beitrag zur Entwicklung der grünen Luftfahrt zu leisten.“
Mit den neuesten Elektroflugzeug-Konstruktionen
AERO unter Strom
Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive
Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive
Electric Flight



- ILA 2024
- Birdy
- Paris Airshow
- Aero 2024
- Aero 2023
- Aero 2022
- Aero 2019
- Aero 2018
- Aero 2017
- Aero 2016
- Aero 2015
- Electrifly-In 2021
- Electrifly-In 2020
- Smartflyer Challenge 2018
- Smartflyer Challenge 2017
- Elektrofliegertreffen Greiling
- Neue Airbus Strategie
- Airbus-Testflieger
- Solar Impulse
- Yuneec
- Leisere Tragschrauber
Projekte




Vorausschauende Böenlastabminderung als Lösung
02.03.2025
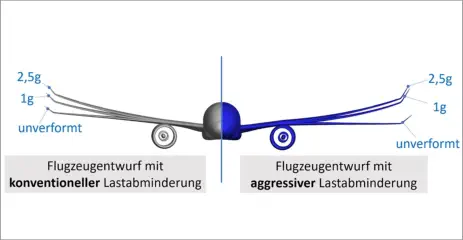
Das experimentell in der Messstrecke des Niedergeschwin-
digkeitswindkanals untersuchte Flügelmodell und der strom-
auf angeordnete Böengenerator ermöglichen eine detallierte
Analyse der Strömungsverhältnisse


Verformungsverhalten der Flugzeugentwürfe mit konventi
oneller (links) und aggressiver Lastabminderung (rechts) im
Reiseflug (1g) und bei einem Abfangmanöver (2.5g). Die
Lasten beim Abfangmanöver sind fast auf das Niveau der
Lasten im Reiseflug abgemindert, wie sich in der Verfor-
mung zeigt.
Schnellreagierende Klappensysteme sollen Passiere und
das Flugzeug selbst vor störenden Böen schützen. Das DLR
hat herausgefunden, wie es umsetzbar ist.
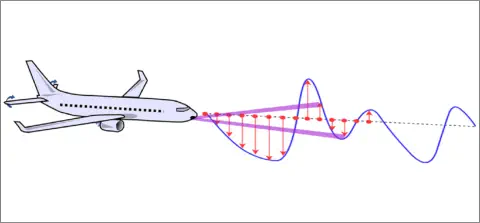
Bild: DLR
Bild: DLR
Im Projekt oLAF hat das DLR intel-
ligente Lastkontrollsysteme für
Flugzeuge untersucht. Sie sollen
Flugzeuge effizienter und komfor-
tabler machen, indem sie die für
das menschliche Auge unsichtbare
Windböen frühzeitig erkennen und
Steuerflächen automatisch anpas-
sen. So lassen sich Treibstoffver-
brauch und Belastung der Tragflä-
chen deutlich senken. Im nächsten
Schritt soll die Technologie in For-
schungsflügen erprobt werden.
Schwerpunkt: Luftfahrt, Klimaver-
trägliches Fliegen
Das Fliegen soll komfortabler und
effizienter werden. Dabei können
unter anderem intelligente Lastkon-
trollsysteme helfen, die voraus-
schauend auf Windböen und Ma-
növer reagieren, indem sie Steuer-
flächen und Klappen blitzschnell
anpassen. Die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des Deut-
schen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) kamen im Projekt
oLAF (Optimal Lastadaptives Flug-
zeug) zu dem Ergebnis, dass ein
Einsatz dieser innovativen Techno-
logie die Belastung der Tragflächen
reduziert und den Passagierkom-
fort erhöht. Der Treibstoffverbrauch
sinkt um bis zu 7,2 Prozent und die
CO2-Emissionen verringern sich
deutlich.
„Durch das geschickte Zusammen-
spiel hochentwickelter Steuerflä-
chen und moderner Sensoren,
können wir Turbulenzen besser
abfedern, die Belastung auf die
Flugzeug-struktur minimieren und
so effizientere Flugzeuge entwikc-
keln“, erklärt Dr. Lars Reimer, Pro-
jektleiter des DLR-Instituts für
Aerodynamik und Strömungstech-
nik. Das geschieht unter anderem
mit Lasersystemen und sogenann-
ten LiDAR-Sensoren, die Windfel-
der per Laser vermessen und he-
rannahende Böen frühzeitig erken-
nen können. Durch diese Senso-
ren kann das Flugzeug noch prä-
ziser und vorausschauender auf
äußere Einflüsse reagieren und
Steuerflächen wie Ruder oder
Klappen automatisch anpassen.
„Der Einsatz hochmoderner Last-
kontrollsysteme reduziert nicht nur
die Materialbelastung und die Le-
bensdauer, sondern verbessert
gleichzeitig die Aerodynamik und
den Wir-kungsgrad moderner
Verkehrsflugzeuge“, so Reimer
weiter.
-
-
Simulationen und Tests
bestätigen großes Potenzial
Im Projekt oLAF haben die DLR-
Forscherinnen und -Forscher un-
tersucht, wie sich der umfassende
Einsatz von Lastkontrolltechnolo-
gien auf den Entwurf eines neuen
Langstreckenflugzeugs auswirkt.
Um das mögliche Potenzial der
Technologie genau abschätzen zu
können, haben sie mittels multidis-
ziplinärer numerischer Simulation
zwei Flugzeugentwürfe mit identi-
schen Anforderungen am Compu-
ter entwickelt und anschlie-ßend
miteinander verglichen: eins mit
herkömmlicher Technik und eines,
das konsequent, von Entwurfsbe-
ginn an, auf hochmoderne, soge-
nannte aggressive Lastreduzierung
ausgelegt ist. Der entscheidende
Unterschied: Die neue Technologie
ermöglicht Tragflächen mit größe-
rer Spannweite und höherer aerod-
ynamischer Effizienz – ein Paradig-
menwechsel, der Treibstoffver-
brauch und Emissionen erheblich
senkt.
Um diese Ergebnisse abzusichern,
haben Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler des DLR-Instituts
für Aeroelastik Versuche im Nieder-
geschwindigkeitswindkanal Braun-
schweig (DNW-NWB) durchge-
führt. Dafür haben sie das Windka-
nalmodell eines elastischen Flü-
gels mit beweglichen Hinterkanten-
klappen und Spoilern versehen
und mithilfe eines eigens entwik-
kelten mobilen Böengenerators
künstliche Böen erzeugt. Die
Schwingungen am Flügel wurden
mit und ohne eingeschaltete Last-
regelung verglichen. Das Resultat:
Mit aktivierter Lastregelung konn-
ten die Schwingungen effektiv re-
duziert und die Belastung am Flü-
gelansatz um bis zu 80 Prozent
verringert werden.
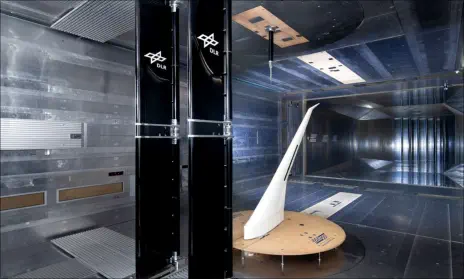
Bild: DLR
Effizientere Tragflächen durch
moderne Lastkontrolle
Die Erkenntnisse aus den Simula-
tionen und den Versuchen zeigen:
Wenn eine umfassende Lastkon-
trolle bereits im Flugzeugentwurf
berücksichtig wird, ermöglicht sie
leichtere, höher gestreckte Trag-
flächen, die aerodynamisch besser
sind und Treibstoff sparen. Das
Flugzeug mit der neuen Technolo-
gie verbraucht den Abschätzungen
zufolge bis zu 7,2 Prozent weniger
Treibstoff und kann trotz möglicher
zusätzlicher Wartungskosten die
Wirtschaftlichkeit um bis zu 6,7
Prozent steigern. „Die Ergebnisse
haben uns überrascht“, sagt Lars
Reimer. „Während wir die Lastkon-
trolle anfangs vor allem als Metho-
de zur Gewichtsreduktion gesehen
haben, stellt sie sich jetzt vielmehr
als Schlüsselelement für den Ent-
wurf der Tragflügel von Morgen dar
- mit deutlich verbesserter Aerody-
namik und höherer Effizienz.“
Nächste Schritte: Technologie in
die Luft bringen
Das DLR plant nun, die Technolo-
gie weiterzuentwickeln und ausge-
wählte erste Prototypen in For-
schungsflugzeugen zu testen. Pa-
rallel dazu setzen die Forschenden
die Arbeiten aus oLAF fort. Sie
wollen den digitalen Entwurfspro-
zess, der alle relevanten Diszi-
plinen – von der Aerodynamik über
die Struktur bis hin zur Lastkon-
trolle – integriert, weiterentwickeln.
Ziel ist es, Flugzeugherstellern ei-
ne Vorgehensweise aufzuzeigen
und hochpräzise Werkzeuge an die
Hand zu geben, mit denen sie
bereits in der frühen Entwurfspha-
se Lastminderungstechnologien in
ihre Designs einplanen können.
06.03.2025
VIP-Passagiere dürfen im Viceroy Seaglider in Clubsesseln
die „Überflüge“ genießen



Fluss- und Küstenregionen sollen ebenso wie vom Festland
nahegelegene Inseln schnell und bequem erreicht werden -
eine alte Idee, die Furore machen könnte

Feierliche Taufe Anfang März 2025 am Kai

Der am Kai angelegte Viceroy Seaglider wurde nach ersten
erfolgreichen Schwimmversuchen wieder an Land gezogen.
Demnächst erfolgt die Flugerprobung.

Von Kai zu Kai
Foto: REGENT
Foto: REGENT

Es ist wohl eine maritime Tradi-
tion, dass Stapelläufe immer
montags erfolgen. Dies lehren
uns zumindest die Macher des
Viceroy Seaglider, einem Aero-
foil-Gleitboot, halb Schiff - halb
Flugzeug. REGENT Craft Inc. ist
das Unternehmen, das nach an-
fänglichen Modellversuchen aus
einem 1:4-Modell nun die erste
Original-Version für 12 Passagie-
re am 3. März zu Wasser brachte.
REGENT leitet sich aus Regional
Electric Ground Effect Nautical
Transport ab.
Kein anderes Luftfahrt-Projekt wur-
de so schnell realisiert wie der
Seaglider mit verteilten elektrisch-
en Antrieben. Mit 12 Passagieren
bei komfortablen Bestuhlungen soll
der Seaglider bis zu 300 km/h Rei-
segeschwindigkeit über die Fluss-
und Küstengewässer bringen. In
der Cargoversion werden 1.600 kg
möglich sein. Die Angaben über
die Geräuschentwicklung sind mit
30 dB unter den Lärmwerten etwas
vage auf Flugzeugen oder Hub-
schraubern bezogen. Dabei muss
das Unternehmen nichts hinter
dem Berg halten, denn der Flügel
des Seaglider wird mit 12 Elektro-
motoren bestückt, die unter der
Flügelvorderkante befestigt wer-
den. Die Spannweite beträgt 19,80
Meter und die Länge des schiffför-
mig ausgebildeten Rumpfes be-
trägt 17,72 Meter. Anderes als bei
Flugzeugen dieser Größenordnung
muss der Seaglider von zwei „Pi-
loten“ geflogen werden. Das 6.500
kg schwere „Flugobjekt“ soll eine
Startleistung von 960 kW bekom-
men. Die Antriebsmotoren sind rein
batteriebetrieben!
Sicherheitsstandards wie bei
Wasser- und Luftfahrzeugen
REGENT strebt an, die Kosten des
regionalen Transports zwischen
Küstenstädten drastisch mit ihrer
Konstruktion zu reduzieren. Ihr als
Viceroy Seaglider bezeichnetes
Fahrzeug ist ein Flügel-im-Boden-
Effekt-Flugzeug, das wenige Meter
über der Wasseroberfläche operiert
und die hohe Geschwindigkeit ei-
nes Flugzeugs mit den niedrigen
Betriebskosten eines Bootes ver-
bindet. Das Vehicle wird nach den
gleichen Sicherheitsstandards wie
alle modernen Luft- und Wasser-
fahrzeuge gebaut und wird mit
heute vorhandener Batterietech-
nologie Strecken von bis zu 180
Meilen (290 km) schaffen.
Know-how von ehemaligen
Boeing-Ingenieuren
Bereits mit der nächsten Batterie-
generation sollen Strecken von bis
zu 500 Meilen (800 km) bewältigt
werden. Der Vorteil ist, dass ein
solches Passagiertransportsystem
alle vorhandenen Dockinfrastruk-
turen nutzen kann. Das Team aus
MIT-ausgebildeten und ehemaligen
Boeing-Ingenieuren nutzt Entwick-
lungspfade für maritime Fahrzeu-
ge, um den emissionsfreien Hoch-
geschwindigkeits-Seegleiter in
kürzester Zeit auf den Markt zu
bringen.-
Wie alle modernen Cockpits wird
auch REGENT’S Seaglider mit mo-
dernen Glascockpits und einem
Autopiloten ausgestattet. Dazu
kommt ein Verkehrsberatungssys-
tem für Luft- und Seefahrt, eine
Infrarotkamera und ein voraus-
schauendes Sonar.
Foto: REGENT
Im Hintergrund ein dick gefülltes
Auftragsbuch
REGENT ist ein durch Risikokapital
finanziertes Startup, dessen Finan-
zierung von Thiel Capital und JAM
Fund geleitet wird. Das Auftrags-
buch ist mit über 7,9 Milliarden US-
Dollar von Fluggesellschaften und
Fährunternehmen, einschließlich
fester Anzahlungen für die ersten
Auslieferungen von Seaglidern gut
gefüllt.
Technik-Chef war selber mit an
Bord
Der erste Schwimmtest in der Nar-
ragansett Bay südlich von Boston/-
USA mit ersten Beschleunigungs-
versuchen auf der stillen Wasser-
oberfläche bestätigten seinen Ma-
chern, dass man zielorientiert auch
Zeitvorgaben durchaus einhalten
kann. Auch Mike Klinker, Mitbe-
gründer und CTO von REGENT,
selber mit an Bord im Zweimann-
Cockpit, zeigte sich begeistert.
„Das erste Mal vom Dock auf den
Vice-roy Seaglider-Prototyp zu
steigen war surreal“ und weiter „Ich
fühlte mich geehrt, im Cockpit zu
sein, als es das Dock zum ersten
Mal verließ und mit den Seeerpro-
bungen begann. Dies war die erste
Reise eines Schiffes, das die Mobi-
lität verändern wird – die Ära der
Seaglider hat begonnen.“
Foto: REGENT
Dank „Foils“ kann eine neue Ära
mit dem Viceroy Seaglider
beginnen
Frühere deutsche Konstruktionen,
auch die in den siebziger und acht-
ziger Jahren durchgeführten Versu-
che mit Airfoils, sind nie richtig aus
dem Experimentalstadium heraus-
gekommen. Zwischenzeitlich ha-
ben die kurz als „Foils“ genannten
Unterwassertragflächen aber be-
sonders bei Hochleistungsyachten
Furore gemacht. Sie sind meist be-
weglich und können vom Inneren
des Bootskörper ein- und ausge-
fahren werden. Zwei Foils hat der
Seaglider unter seinem Rumpf, der
zusammen mit den „verteilten An-
trieben“ auftriebserhöhend wirkt
und den Seaglider nach kürzesten
Zeit der Beschleunigung aus dem
Wasser hebt.Der geringe Abstand
über dem Wasser führt dann zum
Bodeneffekt und das „Schiff-Luft-
fahrzeug“ lässt sich dann wie ein
Flugzeug steuern. Die unter dem
Tragflügel aufgestaute Luft wirkt
dann aber nur auf bis wenige Meter
Höhe. Dort ist die Auftriebskraft
größer als bei frei umströmten Flü-
gel. In diesem Bereich kann dann
der Pilot sogar die Antriebsleistung
eines solchen Seagliders extrem
reduzieren. REGENTs Viceroy
Seaglider hat so die Chance, zu
einem großen Erfolg zu werden,
doch nun muss es auch in der er-
weiterten Erprobungsphase seine
Bodeneffekt- und Flugtüchtigkeit
erweisen.

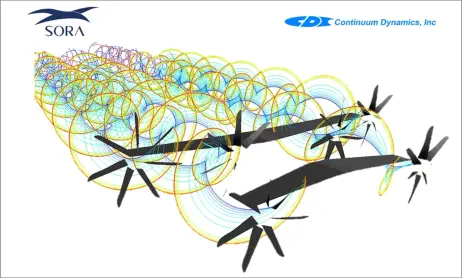

Die Briten drängen in neue Kategorien vor
15.03.2025
Hochwirksame Rotorenanordnung im Marschflugbetrieb


Große Rotordurchmesser für hohe Fluggeschwindgkeiten

Bild: Sora Aviation
Die Masse soll´s bringen
In Großbritannien wagt sich das Unternehmen Sora Aviation an die
Entwicklung eines eVTOL für 30 Passagiere. Gegenüber der in Ent-
wicklung befindlichen eVTOLs ist das der Faktor neun bis zehn. Sora
Aviation rechnet vor, dass sich nach dem Kosten-Nutzen-Faktor klei-
ne VTOLs nicht rechnen würde, weil vier- bis sechssitzige VTOLs
ohnehin schon sehr viel teurer als Hubschrauber sind.
Das Konzept basiert auf einen Ent-
enflügler, der über acht kippbare
Rotoren verfügt. Das als S-1 be-
zeichnete Muster verfügt über ei-
nen röhrenförmigen, langgestreck-
ten Rumpf. -Einen ersten Kunden
habe man auch schon mit dem
koreanischen Hubschrauberbetrei-
reiber Moviation, der 20 Flugzeuge
des Typs S-1 bestellt habe (MoU).
Mit der am 10. März unterschrie-
benen Vorbestellung erklärte man
sich auch bereit, das eVTOL-Mus-
ter S-1 auf dessen drei infrage
kommende Hauptstrecken zu prü-
fen. Dazu gehören der Jamsil He-
liport (betrieben von Moviation)
zum Flughafen Incheon, der vom
Finanzviertel Yeouido zum Flug-
hafen Incheon und der Jamsil He-
liport nach Sejong City, der geplan-
ten koreanischen Verwaltungs-
hauptstadt.
Die Betriebskosten sinken durch
höhere Passagierzahlen
Moviation-CEO Min Shin bezeich-
nete den S-1 als bahnbrechende
Neuerung und sagte, der eVTOL
stehe im Einklang mit Südkoreas
Plänen, den Übergang zur urbanen
Luftmobilität zu beschleunigen.
„Die größere Kapazität und die nie-
drigeren Betriebskosten pro Pas-
sagier im Vergleich zu Hubschrau-
bern und kleineren eVTOLs ma-
chen es ideal für stark nachgefrag-
te Strecken wie Jamsil nach Inche-
on“, sagte er.
Dichte Besiedlungen fordern
nach urbaner Luftmobilität
Südkorea bietet mit seinen dichten
städtischen Gebieten und der star-
ken staatlichen Förderung der ur-
banen Luftmobilität hervorragende
Chancen für den eVTOL-Betrieb.
„Wir freuen uns sehr über die Part-
nerschaft mit Moviation, um effi-
ziente, skalierbare eVTOL-Dienste
nach Südkorea zu bringen“, sagte
Furqan, CEO von Sora Aviation.
„Die S-1 ist nicht nur auf Effizienz
ausgelegt, sondern soll auch dafür
sorgen, dass urbane Luftmobilität
wirklich gleichzeitig für mehr
Menschen zugänglich ist und dass
das nicht nur ein Luxusservice
bleibt.“
Bild: Sora Aviation
Bild: Sora Aviation
Ist Sora S-1 der wahre Airbus?
Er fügte hinzu, dass Moviations
Vorbestellung von 20 Flugzeugen
„die Nachfrage nach eVTOLs mit
höherer Kapazität unterstreicht, die
einen gleichberechtigten Zugang
zur Luftmobilität ermöglichen kön-
nen.“ Die Gründer Furqan und Mal-
colm waren zuvor als Experten für
fortschrittliche Luftmobilität beim
britischen GKN tätig. Schon 2018
entwickelten sie das Konzept eines
eVTOL-Busses – und verfolgen
diese Vision seitdem unermüdlich.
Sora Aviation zieht Know-how
aus US-Unternehmen
Das in Bristol ansässige Unterneh-
men Sora Aviation arbeitet mit dem
US-Unternehmen Continuum Dy-
namics Inc. (CDI) zusammen, um
die Flugdynamikmodellierung,
Aeromechanikanalyse und die
Entwicklung des Proprotors für den
30-sitzigen eVTOL S-1 voranzu-
treiben. CDI, ein führendes Unter-
nehmen auf dem Gebiet der Aero-
dynamik von Drehflüglern und
hochpräzisen Simulationen, verfügt
über jahrzehntelange Erfahrung in
der Unterstützung großer Luft- und
Raumfahrtprogramme.
Förderungen nach denen sich
andere Innovatoren sehnen
Furqan, CEO von Sora Aviation,
erklärte: „Die umfassende Expe-
rtise von CDI in der Kipprotordy-
namik stellt sicher, dass der S-1 für
reale Betriebsherausforderungen
ausgelegt ist – von reibungslosen
Übergangsphasen bis hin zur si-
cheren Bewältigung seltener, aber
kritischer Ausfallfälle.“ Diese Zu-
sammenarbeit wird durch Förder-
mittel von Innovate UK und der
britischen Regierung unterstützt
und stärkt Großbritanniens füh-
rende Position im Bereich nach-
haltiger Luftfahrttechnologien.
Vom 9. bis 12. April findet die 31. AERO in Friedrichshafen
am Bodensee statt. Zwei starke Elemente sind die e-flight-
expo und die Fachkonferenz und das Summit.

Foto: Messe-FN


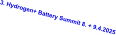
Mit den neuesten Elektroflugzeug-Konstruktionen


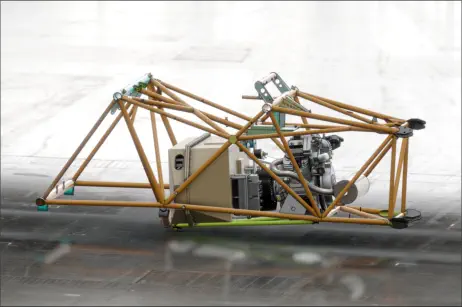





Die AERO ist Vorreiter für die zukunftsweisende
Elektroluftfahrt
16.03.2025
Schweizer Hybrid-Viersitzer Smartflyer SFX1 fliegt
mit sparsamen UL-Motor


Die Basis des Hybrid-Antriebes für die Stemme S10 besteht
aus einem Zweizylinder V-Motor von Briggs & Stratton und
ist mit 5 l/h zufrieden
Foto: Messe-FN

Extremer Leichtflugbau und ein hocheffizienter Geiger-
E-Motor waren die Grundlage für den doppelsitzigen
Elektra-Trainer in der UL-Klasse
Urvater dieses Elektro-Dopelsitzers Alphafrog G1 war
die französische Sirroco, die in ihrer 120 kg-Klasse auch als
KIT-Flugzeug erhältlich sein wird
Foto: Pickan
Als doppelsitziger Trainer zunächst mit Kolbenmotor für
Kunstflug entwickelt, ist Integral E jetzt das elektrische
Folgemuster von Aura Aero aus Frankreich
Die e-Genius der Uni Stuttgart ist nicht nur imstande, weite
Strecken zu meistern, sondern sie bewährt sich auch als
Segelflugzeugschlepper
Cellsius, der Verein, der ETH-Zürich realisierte das E-Flug-
zeug von Sling Aircraft und arbeitet in einem Folgemuster
an einer Maschine mit Brennstoffzellen
Foto: Pimo
Foto: Elektra Solar
Foto: Alphafrog
Foto: AuraAero
Foto: Uni Stuttgart
Foto: Cellsius
Verheißungsvolle Ansätze CO2-
frei zu fliegen, kommen aus der
Allgemeinen Luftfahrt
Was man der Bahn zugutehalten
muss, ist die nahezu CO2-freie
Fortbewegungsart von A nach B.
Noch weit davon entfernt ist die
Luftfahrt mit ihren selbstgesteckten
Zielen, sich möglichst bald von fos-
silen Brennstoffen zu lösen. Doch
was die Allgemeine Luftfahrt be-
trifft, so ist man wie keine andere
Luftfahrtsparte bestrebt, erste
brauchbare Lösungsansätze zu
finden. Dafür steht die AERO! Der
Weg ist verheißungsvoll und heißt:
elektrisches Fliegen, und dem wid-
met sich erneut die e-expo-Halle
A7, an der Ostflanke des Messe-
geländes parallel zum Bodensee
Airport.
AERO unter Strom
Es wäre nicht Europas größte General Aviation Messe AERO, wenn
sie keine Neuheiten zu bieten hätte. Sie ist schlechthin das Schau-
fenster für alles was Flügel, Motoren und Rotoren hat. Genau zur
rechten Jahreszeit im Frühling, wenn auch Aufbruchstimmung in den
verstaubten Flugzeughallen herrscht und wenn das Wetter zu neuen
Nah- und Fernflügen reizt, richtet sich der Blick auf große und kleine
Flugmaschinen. Und wenn der Flug mit dem Business Jet oder
selbst mit der kleinen Zweimot zum Geschäftstermin wieder mehr
Lust verspüren lässt, anstatt zu stressgeladenen Bahnfahrten durch
die Lande mit dem ICE fahren zu müssen, finden sich die besten Ge-
legenheiten nach Neuem Ausschau zu halten. Das gilt gleichwohl für
jeden anderen Piloten, der auch nur zu seinem Freizeitvergnügen
fliegt.
Bedarfsgerechter Viersitzer
Smartflyer aus der Schweiz
Den Anfang dazu machten
Segelflugzeughersteller mit ihren
selbststartenden Motorseglern, de-
nen Motor-Experimentalflugzeuge
folgten und zuletzt Pipistrel mit
seinem Velis. Abgesehen mal von
anderen Einzelstücken. Ihnen fol-
gen jetzt unter anderem die ersten
Viersitzer wie der Smartflyer aus
der Schweiz oder die RX4 E aus
China. Die Schweizer bewegen
sich dabei noch auf vorsichtigem
Terrain, mit einer Hybridlösung auf
Basis eines Rotax-Kolbenmotors.
CEO und Gründer des Unterneh-
mens Rolf Stuber, ehemaliger
Swiss-Pilot, hat den Schwerpunkt
dabei von Anfang an auf eine freie
Sicht aus dem Cockpit gelegt, wäh-
rend sich der eigentliche Antrieb im
Heck befindet. Die Arbeit macht
das Hybridsystem im Bug, das 800
Kilometer Reichweite garantiert.
Doch konzeptionell haben die
Schweizer haben gleich weiterge-
dacht und sehen auch die Möglich-
keiten für reinem Batteriebetrieb
(wenn die mit entsprechenden
Leistungsdichte angeboten wer-
den) und auch den Brennstoffzel-
len-Betriebe vor.
Foto: Messe-FN
Foto: Smartflyer
Der chinesische Elektro-Viersitzer hat bereits auch eine
chinesische Zulassung
Mit modifizierten Stemme S10
will Klaus Ohlmann 2.000
Kilometer weit fliegen
Einen ähnlichen Weg hat Rekord-
pilot Klaus Ohlmann angestoßen,
der in Karl Pickan den Experten,
Besitzer der Firma Pimo, ebenfalls
für einen Hybridantrieb fand. Pick-
an sieht für Ohlmanns Stemme
S10 zunächst eine reine Batterie-
Variante mit einer 30 kWh Lithium-
Batterie vor, die über zwei redun-
dante Inverter - einen slowenisch-
en Emrax-Motor mit 75 kWh - an-
treibt. Dabei wird der Rotax 914-
Verbrenner durch den Elektromotor
ausgetauscht. In der Phase zwei
soll dann mittels Range-Extender
auf Basis eines Briggs & Stratton-
Motors die Reichweite auf über
2000 Kilometer erhöht werden. Der
liefert aus dem angeflanschten
kleinen Generator konstant Strom
an die Pufferbatterie. Mit 15 kW
könne man dann so bis zu 20
Stunden im Kraftflug fliegen und
das bei nur etwa 5 Liter Kraftstoff-
verbrauch pro Stunde. Dieser
smarte Verbrauch ist aber auch nur
dank des hochwertigen Flügels der
S10 umsetzbar. „Eine Neuzula-
ssung ist für das Flugzeug nicht
erforder-lich“, erklärte Pickan, „eine
STC ist rein zulassungsmäßig aus-
reichend“. Noch einfacher sähe es
mit dem Einbau in ein Ultraleicht-
flugzeug aus. Schlucken doch die
Verbrenner nicht selten je nach
Leistung bis zu 18 Liter/Stunde
und das heißt, nicht nur höhere
Treibstoffkosten, sondern auch
höhere Abflugmasse.
Foto: Lianing
Experimentalflugzeuge von
Studenten und deren
weiterführenden Ergebnisse
Rein experimentell beschäftigen
sich gleich mehrere Hochschulpro-
jekte in der „Innovationshalle“ mit
Brennstoffzellensystemen, es sind
die der ETH-Zürich mit Cellsius,
der Aero Delft und in Kooperation
die THWS mit Kasaero. Letztere
wollen den gemeinsam entwickel-
ten Wasserstoffantrieb auch für an-
dere Projekte auf den Markt anbie-
ten, da er auch skalierbar sei. Voll-
kommen autonom präsentieren
sich zum zweiten Mal die Chinesen
mit ihren Viersitzern RX4E, eines
dieser Exponate wird unter ande-
rem auch am 9.4.2025 wie auch
andere Elektroflugzeuge in die Luft
gehen. Und genau das ist neu!
Dass man in Zukunft den Elektro-
und Wasserstoffflugzeugen ein
extra Zeitfenster in weiser Voraus-
sicht schon ab diesem Jahr am
jeweils ersten Messenachmittag
einräumt, ist ein Zugeständnis an
Käufer und Flugenthusiasten, denn
weitere Zulassungen werden auch
in den kommenden Jahren erwar-
tet. So auch Aura Aero.
Sozusagen Stand an Stand liegt
das Duo Ohlmann/Pickan neben
der Spornradversion des doppel-
sitzigen UL-Doppelsitzers Elektra
Trainer. Nach Jahren der Entwick-
lung ist er jetzt zugelassen und
auch in der reinen Zweibeinversion
erhältlich. Erste Flugschulen wur-
den bereits durch eine Kleinserie
bedient. Allerdings kostet der Elek-
tra Trainer inzwischen auch um die
250.000 € voll ausgerüstet. Die UL-
Fliegerei war schon mal preis-
werter!
Universeller Doppelsitzer für
Verbrenner und Kolbenmotor
einsetzbar
Quereinsteiger ist Alphafrog, deren
Stammunternehmen sich seine
Brötchen eigentlich mit einem Soft-
ware-Unternehmen verdient. Das
Basismuster fliegt mit einem EOS
Quattro 30 HP Verbrenner, die
Elektroversion erhält einen Geiger-
Motor mit 20 kW (HPD20/40) was
mit einer Auflastung auf 300 kg
generell den Einstieg in die Elektro-
fliegerei ermöglicht. CEO Marko
Hirsch benennt für den als eG1
bezeichneten Einsitzer dabei einen
Kitpreis von zirka 50.000 Euro. Das
UL mit erweiterter Zulassung ge-
genüber dem alten Muster, das
Anfang der achtziger Jahre als
Sirocco in Frankreich entwickelt
wurde, hat so gut wie überhaupt
nichts mehr mit der heutigen eG1
zu tun. Hirsch hat jedoch noch
ehrgeizigere Ziele und das heißt, er
möchte einen Viersitzer entwick-
eln, der ein ähnliches Antriebssys-
tem wie der e-Genius und der
Smartflyer es besitzen, haben soll.
Sein eG4-Projekt hat dieselben
Ansätze und wird ebenfalls auf
Basis eines Rotax–Verbrenners
entwickelt. Daran wird bereits
gearbeitet.
Aura Aero, der neue große
Player aus Frankreich
Denn mit großen Schritten beweg-
te sich das französische Unterneh-
men Aura Aero in den Markt. Inte-
gral E wird gleich in zwei Version-
en, so auch in der Kolbenmotor-
version präsentiert, doch man wird
auch einen ersten Rumpfspant des
mehrmotorigen Elektroflugzeug
ERA als 19-Sitzer zeigen. Damit ist
auch vorgezeichnet, dass in der
Halle A7 durchaus größere Flug-
zeuge, solange sie noch reinpas-
sen, dort zu sehen sein werden.
Mit von der Partie zugleich auch
erneut wieder das allseits kompe-
tente DLR mit den Vertretungen
verschiedener seiner Institute.
Zweitägiges Fachsymposium
Weitere große und kleine Hersteller
von Elektromotoren, Generatoren,
Brennstoffzellensystemen und Be-
ratungsunternehmen ergänzen die
Angebote der Flugzeughersteller-
und Ausrüster aus Australien und
primär aus europäischen Ländern.
Das DLR ist zugleich auch die Ver-
bindung zu dem einen Stock höher
gelegenen Vortragsraum, wo schon
einen Tag vor Messebeginn das
zweitägige Symposium „Hydrogen
+ Battery Summit“ mit hochgradi-
gen Referenten aus der ganzen
Welt von Australien über ganz Eu-
ropa und Nordamerika startet. Und
danach seine Fortführung im Ne-
benraum mit Flugplatzexperten
über Infrastrukturen berät, wie
schon heute Elektroflugzeuge elek-
trisch oder auch in Zukunft mit
Wasserstoff betankt werden kön-
nen.
In 12 Hallen über 700 Aussteller
Weit mehr als 700 Aussteller sind
dieses Jahr für Europas größte
General Aviation Messe gemeldet.
In der Masse sind Segel- und Ul-
traleichtflugzeuge, Motorsegler,
Drohnen, Hubschrauber, ein- und
zweimotorige Motormaschinen
sowie Business Aircrafts in insge-
samt 12 Hallen untergebracht. Der
sogenannte AERO Business Avi-
ation Show Hub welcher die Hallen
A2, A3 sowie das Business Avi-
ation Static Display mit dem neu
geschaffenen Business Aviation
Dome beinhaltet, präsentiert so
viele Geschäftsreiseflugzeuge wie
noch nie in der Geschichte der
Messe und bietet im neuen Dome
sozusagen auch Begegnungsstät-
te für den VIP-Bereich. Projekt-
leiter der AERO, Tobias Bretzel,
zeigt sich mit dieser Erweiterung
zufrieden: Wir freuen uns sehr
über das Wachstum in dieser so
innovative Branche und die An-
knüpfungspunkte der Business
Aviation an die anderen Themen
und Be-reiche der AERO wie z.B.
bei Zu-lieferern von Avionik- und
Cock-pitsystemen und dem für die
Luft-fahrt so wichtigen Thema von
nachhaltigen Konzepten. Das The-
ma Nachhaltigkeit ist bei der AERO
tief verwurzelt, denn Ökologie und
Ökonomie gehen Hand in Hand.
Der Flottenverbrauch der Flugzeu-
ge liegt heute deutlich niedriger als
noch vor einem Jahrzehnt. Treib-
stoff, den man durch effizientere
Betriebsabläufe oder höhere aero-
dynamische Effizienz einsparen
kann, muss man auch nicht kau-
fen. Wir freuen uns sehr, mit der
AERO 2025 wieder einen Beitrag
zur Entwicklung der grünen Luft-
fahrt zu leisten.“
Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive
Electric Flight
Frühzeitige Böenerkennung